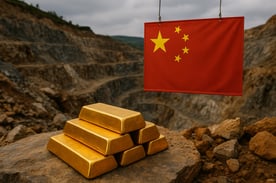Behindertenwerkstätten: Das Milliardengeschäft mit der Barmherzigkeit
Während die Träger von Behindertenwerkstätten sich als edle Samariter inszenieren, verdienen Menschen mit Behinderung durchschnittlich 1,46 Euro pro Stunde. Ein System, das Kritiker als moderne Ausbeutung brandmarken – und das sich hinter einer Mauer des Schweigens verschanzt.
Die Mauer des Schweigens bröckelt
Wer versucht, einen Blick hinter die Kulissen deutscher Behindertenwerkstätten zu werfen, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Thomas Herzberg, Leiter einer Werkstatt der Lebenshilfe in Eberswalde, verweigert nicht nur jeden Einblick in seine Einrichtung – er möchte nicht einmal zitiert werden. Die Presse schreibe ohnehin immer falsch, lässt er wissen. Ein Muster, das sich durch die gesamte Branche zieht: Kontakte werden abgebrochen, Anfragen bleiben unbeantwortet. Man könnte meinen, hier hätte jemand etwas zu verbergen.
Besonders pikant wird es, wenn die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAGWfbM) ihre Pressesprecherin Jana Niehaus vorschickt, die unverblümt erklärt: „Mit Medien wie der JUNGEN FREIHEIT sprechen wir nicht." Eine bemerkenswerte Aussage für eine Organisation, die von öffentlichen Geldern lebt und sich der Transparenz verpflichtet fühlen sollte.
Die bittere Realität hinter wohlklingenden Phrasen
Auf den Hochglanzwebseiten der Werkstätten liest sich alles wunderbar: Von „standardisierten Rahmenlehrplänen" und „binnendifferenzierter beruflicher Qualifizierung" ist die Rede, vom „Konzept des Lebenslangen Lernens" und der Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt. Die Realität spricht eine andere Sprache: Weniger als ein Prozent der Beschäftigten schaffen jemals den Sprung in reguläre Arbeitsverhältnisse. Ein Schelm, wer dabei an ein bewusstes Festhalten billiger Arbeitskräfte denkt.
„Häufig liegt der Stundenlohn sogar noch unter 1,46 Euro. Ausgerechnet die Schwächsten der Gesellschaft werden damit auf das Geschäftsrisiko ihres Arbeitgebers verpflichtet." – Gerrit Huy, AfD-Bundestagsabgeordnete
Die Entlohnung setzt sich aus einem Grundbetrag von mageren 109 Euro und einem variablen Steigerungsbetrag zusammen. Letzterer hängt von der Geschäftslage ab – ein System, das jeden normalen Arbeitnehmer auf die Barrikaden treiben würde. Doch Menschen mit Behinderung haben keine starke Lobby, keine mächtige Gewerkschaft, die für ihre Rechte kämpft.
Ein lukratives Geschäftsmodell für die Träger
Während die Beschäftigten mit Almosen abgespeist werden, floriert das Geschäft der Werkstattbetreiber. Große Unternehmen lagern Aufträge zu Dumpingpreisen aus, die Werkstätten kassieren, und die eigentliche Arbeit verrichten Menschen, die keine Alternative haben. Ein System, das an die dunkelsten Kapitel der Industriegeschichte erinnert – nur dass es heute unter dem Deckmantel der Inklusion daherkommt.
Christoph Lau von der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Behinderte Menschen verteidigt das System mit dem Argument, man könne keine „rein betriebswirtschaftliche" Logik anwenden. Man trenne sich nicht von weniger ertragreichen Aufträgen oder Beschäftigten mit geringer Produktivität. Ein nobles Argument – das allerdings die Frage aufwirft, warum dann überhaupt Gewinne erwirtschaftet werden müssen und warum diese nicht vollständig an die Beschäftigten ausgezahlt werden.
Die politische Dimension des Skandals
Bereits 2019 forderte der Bundestag die damalige Regierung auf, ein „transparentes und zukunftsfähiges Entgeltsystem" zu entwickeln. Passiert ist seitdem: nichts. Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hat sich zwar viel vorgenommen, doch von einer Reform der Behindertenwerkstätten ist bislang keine Rede. Stattdessen pumpt man lieber 500 Milliarden Euro in ein „Sondervermögen" für Infrastruktur – Geld, das künftige Generationen über Steuern und Abgaben zurückzahlen müssen.
Die AfD hat als einzige Partei konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt: Ein an den Mindestlohn gekoppelter Lohnkostenzuschuss und eine Veröffentlichungspflicht für die wirtschaftlichen Ergebnisse der Werkstätten. Transparenz – das Schreckgespenst einer Branche, die sich hinter dem Mantel der Barmherzigkeit versteckt.
Ein persönliches Schicksal verdeutlicht das System
Ein Kommentator berichtet von seinem 22-jährigen Enkel, der trotz geistiger Behinderung eine Ausbildung zum Gärtner absolviert hat – allerdings nur für die Werkstätten. Er bedient elektrische Geräte, fährt Kleintraktor, pflegt Hecken und Wege. Für diese Ganztagsarbeit erhält er 112 Euro im Monat. Zum Vergleich: Ein FSJler bekommt bei gleicher Arbeitszeit mindestens 400 Euro. Die Frage, wie dieser junge Mann jemals selbstständig leben soll, beantwortet sich von selbst.
Zeit für echte Inklusion statt Ausbeutung
Das System der Behindertenwerkstätten in seiner jetzigen Form ist ein Anachronismus, der dringend reformiert werden muss. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2025 Menschen aufgrund ihrer Behinderung von grundlegenden Arbeitnehmerrechten ausgeschlossen werden. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert „gleichen Lohn für gleiche Arbeit" – ein Prinzip, das in deutschen Werkstätten mit Füßen getreten wird.
Die Intransparenz der Branche, die Weigerung, mit kritischen Medien zu sprechen, und die mickrigen Löhne bei gleichzeitigen Gewinnen der Träger zeichnen das Bild eines Systems, das dringend ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden muss. Es ist höchste Zeit, dass die Politik handelt und Menschen mit Behinderung nicht länger als billige Arbeitskräfte zweiter Klasse behandelt werden. Denn wahre Inklusion bedeutet nicht nur Teilhabe, sondern auch faire Bezahlung für geleistete Arbeit.
- Themen:
- #AFD
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik