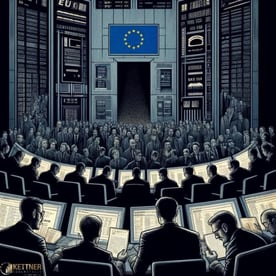Bürgergeld-Umbau: Union will Sozialstaat radikal verschärfen – während die wahren Probleme ungelöst bleiben
Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD startet ihre Herbstklausur in Würzburg mit einem brisanten Thema: der Reform des Bürgergelds. Was als sachliche Debatte über Sozialstaatsreformen verkauft wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als populistischer Feldzug der Union gegen die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Während Unionspolitiker mit markigen Sprüchen um sich werfen und "Terminschwänzer" an den Pranger stellen, zeigen die Fakten ein völlig anderes Bild.
Die Realität hinter den Schlagzeilen
Betrachtet man die nackten Zahlen, wird schnell klar, dass die aufgeregte Debatte um explodierende Bürgergeldkosten auf tönernen Füßen steht. Der Wirtschaftsexperte Maurice Höfgen weist auf einen entscheidenden Punkt hin: Während die nominalen Ausgaben steigen, sinkt der prozentuale Anteil am Bundeshaushalt kontinuierlich. Machten die Kosten 2015 noch 14 Prozent des Bundeshaushalts aus, sind es heute nur noch 10,3 Prozent. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt sank der Anteil von 1,4 auf 1,1 Prozent.
Diese Entwicklung passt so gar nicht ins Narrativ der Union, die von einem außer Kontrolle geratenen Sozialstaat spricht. Noch bemerkenswerter: In den ersten vier Monaten des Jahres 2025 sanken die Zahlungsansprüche der Bürgergeldempfänger sogar um 251 Millionen Euro – ein Trend, der in der öffentlichen Debatte komplett untergeht.
Wer sind eigentlich die "faulen Arbeitslosen"?
Die Union zeichnet gerne das Bild vom arbeitsscheuen Sozialschmarotzer, der es sich in der sozialen Hängematte bequem macht. Die Realität sieht anders aus: Von den 5,52 Millionen Bürgergeldempfängern sind 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Weitere 1,7 Millionen Menschen haben aufgrund von Krankheit oder fehlender Qualifikation Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Etwa 1,2 Millionen beziehen Bürgergeld in Teilzeit, weil sie alleinerziehend sind oder Angehörige pflegen.
Besonders pikant: Rund 800.000 Menschen sind sogenannte "Aufstocker" – sie arbeiten Vollzeit und kommen trotzdem nicht über die Runden. Diese Menschen werden von der Union in Sippenhaft genommen, obwohl sie täglich ihrer Arbeit nachgehen. Die Zahl der tatsächlichen "Totalverweigerer"? Maximal 16.000 Personen – das sind gerade einmal 0,3 Prozent aller Empfänger.
Populismus statt Problemlösung
Während CSU-Politiker wie Markus Ferber "empfindliche Kürzungen" fordern und Alexander Hoffmann einen "echten Systemwechsel" herbeisehnt, bleiben die wahren Probleme ungelöst. Statt sich mit den strukturellen Ursachen von Arbeitslosigkeit auseinanderzusetzen – wie dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, fehlenden Kinderbetreuungsplätzen oder der zunehmenden Prekarisierung des Arbeitsmarktes – wird lieber auf die Schwächsten eingedroschen.
Marc Biadacz' Forderung nach einem Stopp "jeglicher Hilfe" für vermeintliche Arbeitsverweigerer zeigt, wie weit sich die Union von christlich-sozialen Werten entfernt hat. Wo bleibt die vielgepriesene christliche Nächstenliebe, wenn es um Menschen in Not geht?
Die wahren Kostentreiber bleiben unerwähnt
Interessant ist, was in der Debatte nicht thematisiert wird: Die explodierenden Kosten für gescheiterte Integrationspolitik, die Milliarden für fragwürdige Klimaprojekte oder die Verschwendung von Steuergeldern durch ineffiziente Verwaltungsstrukturen. Stattdessen hackt man lieber auf Alleinerziehenden und Kranken herum, die ohnehin schon am Existenzminimum leben.
Die Forderung nach "strengeren Arbeitsanreizen" klingt in Zeiten, in denen selbst Vollzeitbeschäftigte aufstocken müssen, wie blanker Hohn. Vielleicht sollte die Union lieber darüber nachdenken, warum in einem der reichsten Länder der Welt Menschen trotz 40-Stunden-Woche auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.
Ein gefährlicher Weg
Die geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld sind nicht nur sozialpolitisch fragwürdig, sondern auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Wer Menschen in existenzielle Not treibt, schafft keine Arbeitsanreize, sondern Verzweiflung. Die Geschichte lehrt uns, wohin es führt, wenn Gesellschaften ihre schwächsten Mitglieder im Stich lassen.
Statt populistischer Schnellschüsse braucht es eine ehrliche Debatte über die Zukunft unseres Sozialstaats. Dazu gehört auch die unbequeme Wahrheit, dass viele Probleme hausgemacht sind – durch eine verfehlte Migrations-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte. Die Union täte gut daran, sich an ihre sozialen Wurzeln zu erinnern, statt auf dem Rücken der Schwächsten billige Wahlkampfpunkte zu sammeln.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik