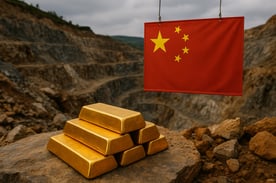Chip-Krise lähmt deutsche Autoindustrie: ZF drosselt Produktion – Europa zahlt den Preis für China-Abhängigkeit
Die deutsche Automobilindustrie steht vor ihrer nächsten selbstverschuldeten Katastrophe. Während die Ampel-Nachfolger in Berlin noch immer von der "Transformation" träumen, zeigt die Realität ihr hässliches Gesicht: Der Zuliefergigant ZF Friedrichshafen muss die Produktion in seinem Herzstück, dem Motorenwerk Schweinfurt, drosseln. Der Grund? Ein Halbleiter-Engpass, der die jahrelange Naivität deutscher Industriepolitik schonungslos offenlegt.
Wenn Abhängigkeit zur Falle wird
Was sich derzeit bei ZF abspielt, ist mehr als nur eine temporäre Lieferkettenstörung. Es ist das Symptom einer chronischen Krankheit, die unsere Wirtschaftseliten jahrelang ignoriert haben. Der niederländische Chiphersteller Nexperia, mittlerweile in chinesischer Hand, kann oder will nicht mehr aus seinen chinesischen Werken exportieren. Peking hat den Hahn zugedreht – als Vergeltung dafür, dass die Niederlande die Kontrolle über das Unternehmen übernommen haben.
Die Ironie könnte bitterer nicht sein: Ausgerechnet jene Konzerne, die jahrelang das Hohelied der Globalisierung sangen und jeden Warner als "Ewiggestrigen" diffamierten, stehen nun mit leeren Händen da. 8.000 Arbeitsplätze allein in Schweinfurt hängen am seidenen Faden chinesischer Gnade.
Die Dominosteine fallen
Doch ZF ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch bei Bosch bereitet man sich bereits auf Kurzarbeit vor. Das Werk für elektronische Steuergeräte könnte ohne kontinuierlichen Nachschub bald stillstehen. Mercedes-Benz, Stellantis, Ford – sie alle hängen am Tropf der Zulieferer, die wiederum von Chips abhängen, die in chinesischen Fabriken produziert werden.
"Gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten arbeiten wir daran, die von Nexperia-Produkten abhängigen Lieferketten stabil zu halten", tönt es aus der ZF-Zentrale.
Man möchte fast lachen, wäre die Situation nicht so ernst. "Alternative Beschaffungsmöglichkeiten prüfen" – das hätte man vor Jahren tun müssen, als noch Zeit war. Stattdessen hat man sich bereitwillig in die Abhängigkeit begeben, getrieben von der Gier nach billigen Komponenten und schnellen Profiten.
Die Rechnung kommt immer
Volkswagen warnte bereits, dass die Erreichung der Finanzziele von der Verfügbarkeit der Halbleiter abhänge. Eine bemerkenswerte Offenbarung für einen Konzern, der sich gerne als Technologieführer inszeniert. Wo bleibt die vielgepriesene deutsche Ingenieurskunst, wenn man nicht einmal in der Lage ist, kritische Komponenten selbst herzustellen oder zumindest aus verlässlichen Quellen zu beziehen?
Die Parallelen zur Energiepolitik sind frappierend. Erst macht man sich von russischem Gas abhängig, dann von chinesischen Chips. Und jedes Mal sind alle überrascht, wenn autoritäre Regime diese Abhängigkeiten als politische Waffe einsetzen. Es scheint, als hätte die deutsche Wirtschaftselite ein pathologisches Bedürfnis, sich in die Hände von Despoten zu begeben.
Ein Weckruf, der ungehört verhallt?
Was wir derzeit erleben, ist kein Betriebsunfall, sondern das logische Ergebnis einer verfehlten Industriepolitik. Während man hierzulande lieber über Gendersternchen und CO2-Neutralität diskutiert, bauen andere Länder ihre strategische Autonomie aus. Die USA unter Trump haben es vorgemacht: America First bedeutet auch, kritische Lieferketten wieder nach Hause zu holen.
Doch was macht die neue Große Koalition unter Merz? Sie plant ein 500-Milliarden-Sondervermögen – nicht etwa für den Aufbau eigener Chip-Fabriken oder die Stärkung der industriellen Basis, sondern für nebulöse "Infrastrukturprojekte" und die Verankerung der Klimaneutralität im Grundgesetz. Man könnte meinen, die Lektion sei nicht angekommen.
Zeit für radikales Umdenken
Die Nexperia-Krise sollte ein Wendepunkt sein. Deutschland und Europa müssen endlich begreifen, dass wirtschaftliche Souveränität kein Luxus, sondern eine Überlebensfrage ist. Das bedeutet nicht Abschottung, aber es bedeutet, bei kritischen Technologien und Rohstoffen nicht von der Gnade autoritärer Regime abhängig zu sein.
Stattdessen brauchen wir eine Renaissance der eigenen Produktion, massive Investitionen in Forschung und Entwicklung und vor allem: den Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Die Globalisierung, wie sie die letzten Jahrzehnte praktiziert wurde, ist gescheitert. Sie hat uns nicht reicher, sondern verwundbarer gemacht.
In Zeiten wie diesen zeigt sich der wahre Wert von Sachwerten. Während Lieferketten zusammenbrechen und Produktionen stillstehen, behalten physische Edelmetalle ihren Wert. Gold und Silber kennen keine Chip-Krise, keine Lieferengpässe und keine politischen Erpressungen. Sie sind die ultimative Versicherung gegen die Unwägbarkeiten einer zunehmend fragilen Weltwirtschaft.
Die Arbeiter in Schweinfurt und anderswo verdienen besseres als Kurzarbeit und Unsicherheit. Sie verdienen eine Politik, die deutsche Interessen vertritt, statt sich in ideologischen Träumereien zu verlieren. Die Nexperia-Krise ist ein Weckruf. Die Frage ist nur: Wer hört noch zu?
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik