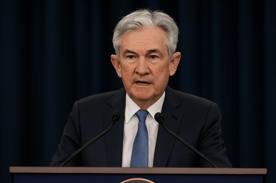Deutsche Bank feiert Rekordgewinne – während der Mittelstand unter Kreditklemme ächzt
Die Deutsche Bank präsentiert stolz ihre glänzenden Quartalszahlen: Mit einem Vorsteuergewinn von 2,4 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2025 erreichte das Geldhaus den höchsten Wert seit achtzehn Jahren. Die Aktie schoss um sechs Prozent nach oben und kletterte auf 28 Euro – ein Niveau, das zuletzt 2015 erreicht wurde. Vorstandschef Christian Sewing sonnt sich im Erfolg und spricht vom "besten zweiten Quartal und ersten Halbjahr seit 2007".
Das Geheimnis des Erfolgs: Weniger Rechtskosten, mehr Profit
Doch was steckt wirklich hinter diesem vermeintlichen Erfolg? Der Blick hinter die Kulissen offenbart: Der Gewinnsprung resultiert hauptsächlich aus einem drastischen Rückgang der Rechtskosten. Während die Bank im Vorjahresquartal noch 1,3 Milliarden Euro für juristische Auseinandersetzungen zurückstellen musste – insbesondere im Zusammenhang mit der umstrittenen Postbank-Übernahme –, konnte sie nun sogar 85 Millionen Euro an Rückstellungen auflösen. Ein buchhalterischer Trick, der die Bilanz aufpoliert?
Die Kosten-Ertrags-Quote sank auf 62,3 Prozent, und die Bank strebt für das Gesamtjahr einen Wert unter 65 Prozent an. Klingt nach effizienter Unternehmensführung – oder nach rigorosem Sparprogramm auf Kosten der Mitarbeiter und Kunden?
Investmentbanking boomt – auf wessen Kosten?
Das Investmentbanking steuerte ein Drittel der Gesamterlöse von 7,8 Milliarden Euro bei. Während die Banker in den Glaspalästen Frankfurts ihre Boni zählen, kämpfen mittelständische Unternehmen um Kredite. Die Kreditvergabe an den produktiven Kern der deutschen Wirtschaft bleibt weiterhin restriktiv – schließlich lässt sich mit spekulativen Geschäften deutlich mehr verdienen als mit der Finanzierung des ehrlichen Handwerkers oder Maschinenbauers.
"Wenn es den Banken gut geht, hat der Bürger zu viel Zinsen usw. abgedrückt!"
Dieser treffende Kommentar eines Lesers bringt es auf den Punkt. Die Rekordgewinne der Deutschen Bank sind kein Grund zum Feiern, sondern ein Alarmsignal. Sie zeigen, wie sehr sich die Finanzwirtschaft von ihrer eigentlichen Aufgabe – der Versorgung der Realwirtschaft mit Kapital – entfernt hat.
Die Schattenseiten des Erfolgs
Besonders aufschlussreich ist der Blick auf das Privatkundengeschäft: Hier verfehlte die Bank ihr internes Rentabilitätsziel von zehn Prozent Eigenkapitalrendite. Die Botschaft ist klar: Der normale Sparer und Kreditnehmer ist für die Deutsche Bank nur noch lästiges Beiwerk. Lieber konzentriert man sich auf lukrative Großgeschäfte und spekulative Finanzprodukte.
Gleichzeitig schwächelt der Bereich Origination and Advisory mit einem Umsatzrückgang von 29 Prozent. Die Bank verlor Marktanteile an US-Konkurrenten – ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr die deutsche Finanzwirtschaft international an Boden verliert. Die erhoffte "leichte Erholung" im zweiten Halbjahr dürfte eher Wunschdenken als realistische Prognose sein.
Was bedeutet das für den deutschen Sparer?
Während die Deutsche Bank Rekordgewinne einfährt, leiden Millionen deutscher Sparer unter der Inflation und den Folgen der verfehlten Geldpolitik. Die Zinsen auf Spareinlagen bleiben mickrig, während die Bank mit dem Geld ihrer Kunden satte Renditen erwirtschaftet. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter – befeuert von einem Finanzsystem, das längst seine dienende Funktion verloren hat.
In Zeiten wie diesen zeigt sich einmal mehr: Wer sein Vermögen schützen will, sollte nicht allein auf Bankprodukte setzen. Physische Edelmetalle wie Gold und Silber bieten einen bewährten Schutz vor Inflation und Finanzkrisen. Sie sind unabhängig von den Launen der Finanzmärkte und den fragwürdigen Geschäftspraktiken der Großbanken.
Fazit: Cui bono?
Die Rekordgewinne der Deutschen Bank mögen die Aktionäre erfreuen und Vorstandschef Sewing zu Jubelgesängen verleiten. Für die deutsche Wirtschaft und die Bürger sind sie jedoch kein Grund zur Freude. Sie dokumentieren vielmehr die zunehmende Abkopplung der Finanzwirtschaft von ihrer eigentlichen Aufgabe: der Versorgung der Realwirtschaft mit Kapital und der treuhänderischen Verwaltung der Ersparnisse der Bürger.
Es wird Zeit, dass die Politik endlich handelt und die Banken wieder an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnert. Doch von der aktuellen Großen Koalition unter Friedrich Merz ist hier wenig zu erwarten. Zu eng sind die Verflechtungen zwischen Politik und Finanzwirtschaft, zu groß die Angst vor unpopulären Entscheidungen.
Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik