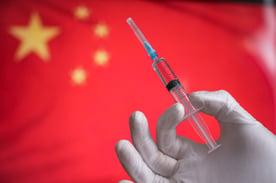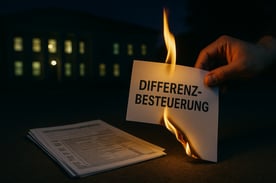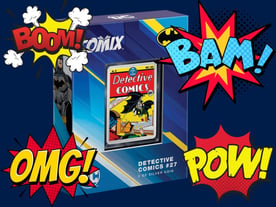
Arbeitszeitreform: Wenn die Wählscheibe auf die Digitalisierung trifft
Die deutsche Arbeitswelt steht vor einem Scheideweg, der symptomatisch für die Herausforderungen unseres Landes ist. Während Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger eine längst überfällige Reform des Arbeitszeitgesetzes fordert, klammern sich die Gewerkschaften an Regelungen aus einer Zeit, als das Faxgerät noch als technische Innovation galt. Ein Konflikt, der zeigt, wie sehr Deutschland zwischen Fortschritt und Beharrungsvermögen gefangen ist.
Die Realität der modernen Arbeitswelt
Dulgers Vergleich trifft ins Schwarze: Das deutsche Arbeitszeitgesetz stamme aus der Ära von "Telex und Wählscheibe". In einer Zeit, in der Arbeitnehmer von überall arbeiten können, in der die Grenzen zwischen Büro und Homeoffice verschwimmen, hält Deutschland an starren Regelungen fest, die eher an die Stechuhr im Industriezeitalter erinnern als an die Flexibilität des 21. Jahrhunderts.
Die aktuelle Gesetzeslage sieht vor, dass Arbeitnehmer täglich maximal acht Stunden arbeiten dürfen, mit einer möglichen Verlängerung auf zehn Stunden unter bestimmten Bedingungen. Nach Arbeitsende müssen elf Stunden Ruhezeit eingehalten werden. Was in der Theorie nach Arbeitnehmerschutz klingt, erweist sich in der Praxis oft als Hemmschuh für beide Seiten.
Flexibilität als Schlüssel zur Vereinbarkeit
Das von Dulger skizzierte Szenario kennt jeder moderne Arbeitnehmer: Um 16 Uhr das Kind aus der Kita abholen, abends noch zwei E-Mails beantworten und trotzdem am nächsten Morgen pünktlich im Büro sein. Nach geltendem Recht ein Ding der Unmöglichkeit. Die starre Elfstundenregel macht aus engagierten Mitarbeitern potenzielle Gesetzesbrecher.
"Eine wöchentliche Höchstarbeitszeit passt besser in das Zeitalter der Digitalisierung als die strikte tägliche Höchstarbeitszeit"
Diese Aussage Dulgers bringt die Kernforderung auf den Punkt: Weg von der täglichen, hin zur wöchentlichen Betrachtung der Arbeitszeit. Ein Ansatz, der in vielen europäischen Ländern längst Realität ist und der es ermöglichen würde, die Möglichkeiten der EU-Arbeitszeitrichtlinie voll auszuschöpfen.
Der gewerkschaftliche Widerstand
Erwartungsgemäß stellen sich die Gewerkschaften quer. DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnt vor einer "Abschaffung des regulären Achtstundentags" und verweist auf die bereits heute geleisteten, oft unbezahlten Überstunden. Eine Argumentation, die zwar populär klingt, aber am Kern der Debatte vorbeigeht.
Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung schlägt in dieselbe Kerbe und warnt vor Arbeitszeiten von mehr als zwölf Stunden täglich. Dabei übersieht sie geflissentlich, dass es nicht um die Ausweitung der Arbeitszeit geht, sondern um deren flexiblere Verteilung. Dulger betont ausdrücklich, es gehe nicht darum, "alle täglich 13 Stunden schuften zu lassen".
Die Große Koalition zwischen den Stühlen
Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz hat sich im Koalitionsvertrag zur Reform bekannt. Die Formulierung, man wolle "im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen", klingt nach einem vernünftigen Kompromiss. Doch wie so oft in der deutschen Politik droht auch diese Reform im Klein-Klein der Sozialpartnerschaft zu versanden.
Der kürzlich gestartete Dialog mit den Sozialpartnern erinnert an die typisch deutsche Konsenssuche, die oft genug zur Blockade führt. Während andere Länder voranschreiten, diskutiert Deutschland. Während die Digitalisierung galoppiert, traben wir im Schritttempo hinterher.
Ein Blick über den Tellerrand
Die Ironie der Geschichte: Während Deutschland über Flexibilisierung debattiert, haben andere Länder längst Fakten geschaffen. In vielen EU-Staaten ist die wöchentliche Betrachtung der Arbeitszeit Standard. Die deutsche Wirtschaft verliert durch starre Regelungen an Wettbewerbsfähigkeit, während gleichzeitig qualifizierte Fachkräfte ins Ausland abwandern, wo sie flexiblere Arbeitsbedingungen vorfinden.
Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Berufsgruppen, die Dulger vornimmt, ist dabei durchaus sinnvoll. Ein Dachdecker oder Montagearbeiter hat andere Bedürfnisse als ein IT-Spezialist im Homeoffice. Genau diese Differenzierung ermöglicht es, passgenaue Lösungen zu finden, statt alle über einen Kamm zu scheren.
Die verpasste Chance der Digitalisierung
Deutschland, einst Vorreiter in Sachen Arbeitnehmerrechte, droht zum Nachzügler zu werden. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen für eine bessere Work-Life-Balance, für effizienteres Arbeiten und mehr Selbstbestimmung. Doch statt diese Chancen zu nutzen, verharren wir in Strukturen, die für eine andere Zeit geschaffen wurden.
Die Gewerkschaften täten gut daran, ihre reflexhafte Abwehrhaltung zu überdenken. Moderne Arbeitszeitmodelle bedeuten nicht automatisch Ausbeutung. Im Gegenteil: Sie können zu mehr Zufriedenheit, höherer Produktivität und besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen. Voraussetzung ist allerdings, dass man bereit ist, alte Zöpfe abzuschneiden.
Fazit: Zeit für mutige Reformen
Die Debatte um das Arbeitszeitgesetz ist mehr als nur eine arbeitsrechtliche Detailfrage. Sie steht exemplarisch für die Reformfähigkeit Deutschlands. Werden wir es schaffen, uns von überholten Strukturen zu lösen und die Chancen der Moderne zu nutzen? Oder verharren wir in einer Komfortzone, die längst zur Falle geworden ist?
Die neue Bundesregierung hat die Chance, hier ein Zeichen zu setzen. Eine Reform des Arbeitszeitgesetzes wäre ein wichtiger Schritt, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Doch dafür braucht es Mut, sich auch gegen gewerkschaftliche Widerstände durchzusetzen. Die Alternative ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte der verpassten Chancen, die Deutschland in den letzten Jahren geschrieben hat.
In einer Zeit, in der andere Länder voranpreschen, können wir es uns nicht leisten, an Regelungen aus der Steinzeit der Digitalisierung festzuhalten. Die Wählscheibe hat ausgedient – es wird Zeit, dass auch unser Arbeitsrecht im 21. Jahrhundert ankommt.
- Themen:
- #CDU-CSU

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik