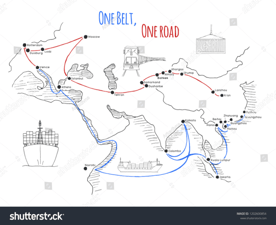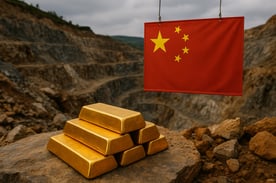Chinas Industrieprofite: Pekings Kampf gegen ruinöse Preiskämpfe zeigt erste Wirkung
Die chinesischen Industriegewinne sind im Juli nur noch um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken – ein deutliches Signal dafür, dass Pekings Maßnahmen gegen die zerstörerischen Preiskämpfe in der Wirtschaft erste Früchte tragen. Nach monatelangen dramatischen Einbrüchen scheint sich die Lage zu stabilisieren, doch die Frage bleibt: Kann das kommunistische Regime die selbstgeschaffenen Probleme seiner Planwirtschaft wirklich lösen?
Von der Klippe zurückgetreten – vorerst
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während die Gewinne im Mai noch um satte 9,1 Prozent einbrachen und im Juni immerhin noch 4,3 Prozent nachgaben, hat sich der Rückgang im Juli merklich verlangsamt. Das Nationale Statistikbüro Chinas verkauft dies als Erfolg der staatlichen Interventionen. Doch ein genauerer Blick offenbart die tieferliegenden Probleme des chinesischen Wirtschaftsmodells.
Besonders dramatisch zeigt sich die Krise im Bergbausektor, wo die Profite in den ersten sieben Monaten des Jahres um erschreckende 31,6 Prozent einbrachen. Staatliche Industrieunternehmen – einst das Rückgrat der kommunistischen Wirtschaftsordnung – verzeichneten einen Gewinnrückgang von 7,5 Prozent. Nur ausländische Investoren und private chinesische Unternehmen konnten ihre Gewinne steigern, was die Ineffizienz staatlicher Betriebe schonungslos offenlegt.
Der verzweifelte Kampf gegen "Neijuan"
Was die Chinesen euphemistisch als "Neijuan" bezeichnen – übermäßiger Wettbewerb, der zu ruinösen Preiskämpfen führt – ist nichts anderes als das Symptom einer fundamental fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik. Jahrzehntelange Überinvestitionen, staatlich gelenkte Kreditvergabe und die Missachtung marktwirtschaftlicher Prinzipien haben zu massiven Überkapazitäten geführt. Nun versucht Peking mit "Anti-Involutions-Maßnahmen" das zu reparieren, was es selbst angerichtet hat.
"Die Anti-Involutions-Kampagne ist ebenso politisch wie wirtschaftlich motiviert", analysiert Gabriel Wildau von der Beratungsfirma Teneo treffend. Die Führung wolle demonstrieren, dass sie die Probleme von Unternehmen und Investoren ernst nehme – auch wenn die tatsächlichen politischen Reaktionen höchst inkrementell seien.
Deflation als Dauerzustand?
Die Erzeugerpreise befinden sich weiterhin im freien Fall. Die Fabrikdeflation hat sich im Juni und Juli verschärft und das schlimmste Niveau seit zwei Jahren erreicht. Dies ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern das Resultat einer schwachen Binnennachfrage kombiniert mit chronischen Überkapazitäten – ein toxischer Cocktail, den Peking selbst gemixt hat.
Tianchen Xu vom Economist Intelligence Unit sieht zwar "frühe Effekte der Anti-Involution" in leicht gestiegenen Gewinnmargen, doch diese marginalen Verbesserungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass China vor fundamentalen strukturellen Problemen steht. Die Erwartung, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August zum fünften Mal in Folge im kontraktiven Bereich verharren wird, spricht Bände.
Keine Wiederholung des Wunders von 2015
Analysten warnen eindringlich davor, eine Wiederholung des starken Preisanstiegs nach den angebotsseitigen Reformen vor einem Jahrzehnt zu erwarten. Die damaligen Maßnahmen führten zu einer drastischen Kapazitätsbereinigung und einem kräftigen Anstieg der Erzeugerpreise. Doch die heutigen "Anti-Involutions-Politiken" sind zaghafter, inkrementeller – und vor allem: Sie adressieren nicht die Wurzel des Problems.
Die harte Wahrheit ist: Solange Peking nicht bereit ist, echte marktwirtschaftliche Reformen durchzuführen und ineffiziente Staatsunternehmen sterben zu lassen, wird die Deflation oder Disinflation anhalten. Wildau bringt es auf den Punkt: Die Preisabwärtsspirale werde sich fortsetzen, "bis Marktdruck zu einer Konsolidierung der Industrie und dem Ausscheiden nicht wettbewerbsfähiger Unternehmen führt".
Lehren für Deutschland und Europa
Während China mit den Folgen seiner Planwirtschaft kämpft, sollten wir in Deutschland genau hinschauen. Die zunehmende staatliche Intervention in unsere Wirtschaft, die Subventionierung unrentabler Industrien und die ideologisch getriebene Energiepolitik führen uns auf einen ähnlich gefährlichen Pfad. Chinas Probleme heute könnten unsere Probleme morgen sein, wenn wir nicht umsteuern.
In Zeiten solcher wirtschaftlicher Unsicherheiten – sei es in China oder bei uns – zeigt sich einmal mehr der Wert physischer Edelmetalle als stabiler Anker im Portfolio. Während Industriegewinne einbrechen und Währungen unter Druck geraten, behalten Gold und Silber ihren intrinsischen Wert. Sie sind keine spekulative Wette, sondern eine bewährte Versicherung gegen die Folgen verfehlter Wirtschaftspolitik.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik