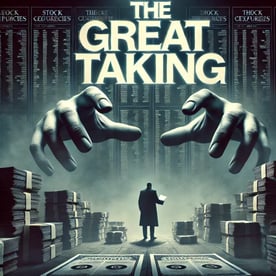Das Ende der Privilegien: Wie DEI-Kürzungen und Sozialabbau Amerika erschüttern
Die Zeiten des bequemen Lebens auf Kosten der Steuerzahler scheinen in den USA ihrem Ende entgegenzugehen. Was sich derzeit jenseits des Atlantiks abspielt, könnte als Lehrstück dafür dienen, wohin jahrzehntelange Umverteilungspolitik und identitätsbasierte Bevorzugung führen: in die Abhängigkeit und letztlich in den wirtschaftlichen Absturz ganzer Bevölkerungsgruppen.
Die große Ernüchterung nach dem DEI-Rausch
Über 300.000 afroamerikanische Frauen hätten seit Februar ihre Arbeitsplätze verloren, heißt es aus den Vereinigten Staaten. Die Arbeitslosenquote in dieser Bevölkerungsgruppe sei auf fast sieben Prozent gestiegen. Der Grund? Das Ende der sogenannten "Diversity, Equity and Inclusion"-Programme, kurz DEI. Was jahrelang als Heilsbringer für mehr Gerechtigkeit gepriesen wurde, entpuppt sich nun als das, was kritische Beobachter schon lange vermuteten: ein künstliches Konstrukt, das Menschen nicht nach Leistung, sondern nach Hautfarbe in Positionen hievte.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Zwischen 2010 und 2024 sei die Beschäftigung afroamerikanischer Frauen in Bürojobs um sagenhafte 103 Prozent gestiegen. Nicht etwa, weil plötzlich eine Qualifikationsexplosion stattgefunden hätte, sondern weil Unternehmen mit Steuervorteilen und staatlichen Zuschüssen geködert wurden, ihre Quoten zu erfüllen. Nun, da der Geldhahn zugedreht wird, zeigt sich die harte Realität: Wer nur aufgrund seiner Identität und nicht seiner Fähigkeiten eingestellt wurde, ist plötzlich verzichtbar.
Die Wurzeln des Übels: Johnsons "Great Society"
Die aktuelle Misere hat tiefe historische Wurzeln. Bereits in den 1960er Jahren legte Präsident Lyndon B. Johnson mit seinen "Great Society"-Programmen den Grundstein für eine verhängnisvolle Entwicklung. Was als Hilfe für Bedürftige verkauft wurde, entpuppte sich als perfides System zur Wählerbindung. Besonders perfide: Alleinerziehende Mütter erhielten mehr Geld, je mehr Kinder sie hatten – solange kein Vater im Haushalt lebte.
Die Folgen dieser Politik seien verheerend gewesen: Die Scheidungsrate unter afroamerikanischen Frauen sei von 17 Prozent im Jahr 1960 auf 48 Prozent im Jahr 2024 explodiert. Der Anteil alleinerziehender Mütter in der schwarzen Community habe sich von 20 auf erschreckende 65 Prozent mehr als verdreifacht.
Der renommierte Ökonom Thomas Sowell bezeichne diese Wohlfahrtsprogramme als zerstörerischer für die afroamerikanische Gemeinschaft als jedes andere Ereignis in der US-Geschichte – einschließlich der Sklaverei. Eine vernichtende Bilanz für eine Politik, die angeblich helfen sollte.
Der doppelte Schlag: DEI-Ende trifft auf Sozialkürzungen
Als wäre der Verlust der künstlich geschaffenen Arbeitsplätze nicht genug, trifft nun ein zweiter Schlag die betroffenen Gruppen: Kürzungen bei den Lebensmittelmarken (SNAP/EBT). Etwa 25 Prozent der afroamerikanischen Haushalte seien auf diese Unterstützung angewiesen – im Vergleich zu nur acht Prozent der weißen Haushalte. Rund 1,3 Millionen Familien stünden vor dem Verlust dieser Leistungen.
Die Empörung unter den Betroffenen sei groß: Man verlange von ihnen tatsächlich, sich um Arbeit zu bemühen oder eine Stelle anzunehmen, um weiterhin Unterstützung zu erhalten. Was für arbeitende Steuerzahler eine Selbstverständlichkeit ist, wird hier als Zumutung empfunden – ein deutliches Zeichen dafür, wie tief die Abhängigkeitsmentalität bereits verwurzelt ist.
Lehren für Deutschland: Wohin führt der Weg?
Was sich in den USA abspielt, sollte auch hierzulande aufhorchen lassen. Die Ampel-Koalition mag Geschichte sein, doch die von ihr vorangetriebene Identitätspolitik wirkt nach. Quotenregelungen, Gendersprache und die ständige Bevorzugung bestimmter Gruppen schaffen keine Gerechtigkeit – sie schaffen Abhängigkeiten und zerstören das Leistungsprinzip.
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz täte gut daran, aus den amerikanischen Erfahrungen zu lernen. Eine Gesellschaft kann nicht auf subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen aufgebaut werden. Nur Leistung und Verdienst halten eine Wirtschaft am Laufen. Alles andere führt in die Sackgasse – wie die verzweifelten Gesichter jener zeigen, die nun erkennen müssen, dass Hautfarbe eben doch keine Qualifikation ist.
Die unbequeme Wahrheit
Die Kritiker der DEI-Programme hätten es als "Abrechnung" bezeichnet – nach 15 Jahren des Lebens im "Easy Mode" müssten die Begünstigten nun lernen, dass Verdienst mehr zähle als Identität. So hart diese Einschätzung klingen mag, so sehr trifft sie den Kern des Problems: Eine auf Umverteilung und Identitätspolitik basierende Gesellschaft ist nicht nachhaltig. Sie schafft Abhängigkeiten statt Eigenverantwortung, Anspruchsdenken statt Leistungsbereitschaft.
Die amerikanische Entwicklung zeigt eindrucksvoll, wohin der Weg führt, wenn Politik zur reinen Klientelbedienung verkommt. Es bleibt zu hoffen, dass auch in Deutschland rechtzeitig die Notbremse gezogen wird, bevor ganze Bevölkerungsgruppen in die gleiche Abhängigkeitsfalle tappen. Denn am Ende zahlt immer der arbeitende Steuerzahler die Zeche – bis auch er nicht mehr kann oder will.
In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Verwerfungen zeigt sich einmal mehr: Wahre Sicherheit bieten nicht staatliche Versprechungen, sondern reale Werte. Physische Edelmetalle wie Gold und Silber haben sich über Jahrhunderte als krisenfeste Anlage bewährt und sollten in keinem ausgewogenen Portfolio fehlen.
- Themen:
- #Steuern

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik