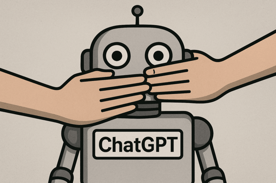
Das Ende der westdeutschen Selbstgewissheit: Wenn der Lehrmeister zum Schüler wird

Drei Jahrzehnte lang erklärte der Westen dem Osten, wie die Welt funktioniert. Nun bröckelt das eigene Fundament, und plötzlich erscheint die ostdeutsche Erfahrung des Systemzusammenbruchs als wertvolles Wissen. Die sogenannte „Westalgie" ist da – und mit ihr eine unbequeme Wahrheit.
Ein Satz, der sitzt
„Westalgie ist total unterschätzt. Alle reden über Ostalgie. Aber jetzt erwischt es die Wessis." Diese Worte, ausgesprochen von einem westdeutschen Verleger bei einer Veranstaltung im Berliner Theater Ost, treffen einen Nerv. Was jahrzehntelang als ostdeutsches Phänomen belächelt wurde – die Sehnsucht nach einer untergegangenen Ordnung – erfasst nun auch jene, die sich stets als Sieger der Geschichte wähnten.
Die Diagnose ist schonungslos: Das westdeutsche Erfolgsmodell, diese vermeintliche Heilsgewissheit, dieser selbsterklärte Endpunkt der Geschichte, gerät ins Wanken. VW entlässt Tausende im Herzland des deutschen Wohlstands. Die transatlantische Sicherheitsarchitektur? Unter der zweiten Trump-Administration zur Farce verkommen. Die regelbasierte Weltordnung? Vom kanadischen Premierminister Mark Carney in Davos als „bequeme Lüge" entlarvt.
Die Illusion der Insel
Um die Tiefe dieser westdeutschen Selbsttäuschung zu begreifen, lohnt ein Blick auf West-Berlin. Nicht die Mythen von der „Insel der Freiheit", sondern die nüchterne Realität einer Stadt, die 39 Jahre lang künstlich beatmet wurde. Fast 245 Milliarden D-Mark pumpte die Bundesrepublik zwischen 1950 und 1989 in die eingemauerte Enklave – mehr, als diese selbst erwirtschaftete. Ein Paradies auf Pump, das nur existieren konnte, weil der Kalte Krieg es benötigte.
Als die Mauer fiel, endete nicht nur die DDR. Auch West-Berlin als politisches Projekt war Geschichte. Doch diese Erkenntnis wurde verdrängt, überlagert vom Triumphgefühl des vermeintlichen Sieges. Man analysierte lieber ostdeutsche Defizite, therapierte sie weg, anstatt die eigenen Risse zu betrachten.
Das ostdeutsche Schulterzucken
Während der Westen nun erschüttert wird wie der Osten 1989/90, reagieren jene, die den Zusammenbruch bereits durchlebten, mit bemerkenswerter Gelassenheit. Dieses ostdeutsche Schulterzucken ist kein Desinteresse – es ist die Anerkennung einer Wahrheit, die Ostdeutsche seit über drei Jahrzehnten kennen: Alles kann sich über Nacht ändern. Jede Biografie kann brüchig werden. Nichts ist sicher.
„Wir Ossis haben das schon durch. Die Normen brechen weg, das System kollabiert, die Gewissheiten erodieren. Das passiert ja gerade. Und ihr haltet uns auf."
Die AfD-Legende als Ablenkungsmanöver
Besonders entlarvend zeigt sich die westdeutsche Selbsttäuschung in der Debatte um den Rechtspopulismus. Noch immer wird die AfD als „ostdeutsches Problem" inszeniert, als Beweis für vermeintliche Demokratiedefizite jenseits der ehemaligen Grenze. Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Die Partei entstand 2013 in Oberursel bei Frankfurt am Main – mitten im Westen. Ihr Bundesvorstand ist bis auf wenige Ausnahmen westdeutsch dominiert.
Die hohen AfD-Ergebnisse in den östlichen Bundesländern sind in erster Linie ein Zeichen dafür, dass etablierte Parteien über Jahre hinweg die realen Sorgen und die Lebensrealität der Menschen nicht ausreichend wahrgenommen haben. Die daraus entstandene Frustration und das Gefühl, politisch nicht gehört zu werden, haben ein Vakuum hinterlassen. Dass ausgerechnet jene, die dieses Vakuum mitverursacht haben, nun mit dem Finger auf den Osten zeigen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Vom Defizit zur Ressource
In dieser Krise liegt jedoch auch eine historische Chance. Vielleicht können wir endlich aufhören, in den Kategorien von Siegern und Besiegten zu denken. Die ostdeutsche Erfahrung ist kein Defizit, sondern ein Wissen – das Wissen, wie man lebt, wenn die großen Erzählungen zerbrechen. Wie man neu anfängt, auch wenn einem niemand den Weg zeigt. Dass Heimat nichts Statisches ist, sondern etwas, das man sich täglich neu erarbeiten muss.
Damit ist der Osten zur unerwarteten Avantgarde geworden. Zur Speerspitze einer Erfahrung, die bald alle teilen werden: dass Sicherheit eine Illusion war und dass wahre Resilienz aus der Fähigkeit zum Neuanfang erwächst. Diese Kompetenz wird jetzt gebraucht – nicht nur im Osten, sondern überall.
Zeit für Brücken statt Belehrungen
Mehr als 30 Jahre lebten wir in parallelen Realitäten. Der Westen in seiner Siegererzählung, der Osten in Transformationserschöpfung. Jetzt teilen wir eine gemeinsame Erfahrung: die Erfahrung der Fragilität, die Erkenntnis, dass Stabilität nichts Naturgegebenes ist.
Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz täte gut daran, diese Erkenntnis ernst zu nehmen. Statt weitere 500 Milliarden Euro Schulden aufzutürmen und damit kommende Generationen zu belasten, wäre echte Reformbereitschaft gefragt. Doch wer glaubt schon daran, dass ein Politiker, der seine Erkenntnisse angeblich 10.000 Meter über den alltäglichen Sorgen der Bürger findet, die Bodenhaftung besitzt, die es jetzt bräuchte?
Die „Westalgie" ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist der Beginn einer notwendigen Ernüchterung. Und vielleicht – nur vielleicht – der Anfang einer ehrlicheren deutschen Debatte. Einer Debatte, in der der Westen endlich zuhört und der Osten endlich gehört wird. In der wir gemeinsam eine neue Ordnung erschaffen, anstatt in Schwarz und Weiß, in Ost und West zu denken. Die Zeit dafür wäre reif.

Enteignungswelle 2026
Kostenloses Live-Webinar: Dominik Kettner und 6 hochkarätige Gäste enthüllen, wie digitaler Euro, verpflichtende digitale ID und das geplante EU-Vermögensregister Ihr Erspartes bedrohen – und welche konkreten Schritte Sie jetzt unternehmen müssen, um Ihr Vermögen zu schützen.
Die Experten
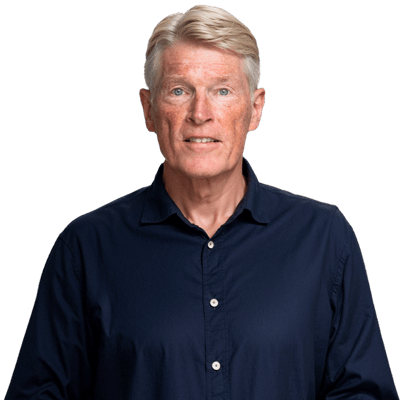
Ernst
Wolff
Bestseller-Autor
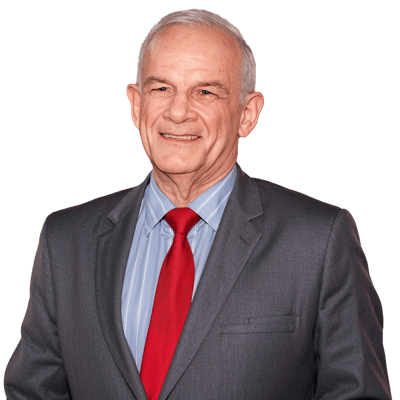
Peter
Hahne
Ex-ZDF, Bestseller-Autor

Tom-Oliver
Regenauer
Autor & Systemanalyst

Philip
Hopf
Finanzanalyst
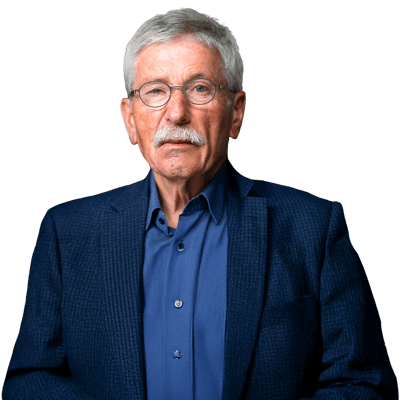
Thilo
Sarrazin
Bundesbank-Vorstand a.D.

Thurn
und Taxis
Fürstin & Finanzexpertin
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












