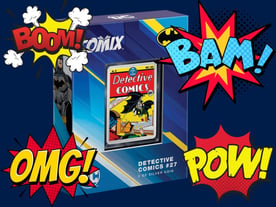
Der Namensstreit um Marie Curie: Wenn Nationalstolz auf Euroscheine trifft
Es ist schon bemerkenswert, wie ein simpler Name auf einem Geldschein die europäischen Gemüter erhitzen kann. Die Europäische Zentralbank (EZB) plant eine neue Serie von Euro-Banknoten, und ausgerechnet bei der 20-Euro-Note entbrennt nun ein alter Konflikt zwischen Polen und Frankreich neu. Im Zentrum steht Marie Curie – oder sollte man besser sagen: Maria Skłodowska-Curie?
Ein Name, zwei Nationen, unendliche Diskussionen
Die zweifache Nobelpreisträgerin, die als erste Frau überhaupt einen Nobelpreis erhielt und bis heute die einzige Person ist, die in zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen diese Auszeichnung bekam, soll möglicherweise die neue 20-Euro-Note zieren. Doch kaum hatte die EZB ihre Vorschlagsliste veröffentlicht, meldete sich Polen zu Wort: Wo, bitte schön, sei der Geburtsname Skłodowska geblieben?
Man könnte meinen, in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen hätten europäische Diplomaten Wichtigeres zu tun. Doch polnische Beamte sahen sich genötigt, die EZB auf diese "Ungenauigkeit" hinzuweisen. Selbst der polnische Zentralbankgouverneur Adam Glapiński griff zur Feder und schrieb einen Brief an EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Als ob das nicht genug wäre, schalteten sich auch noch polnische EU-Abgeordnete ein – und sogar einige nicht-polnische Parlamentarier, die sich plötzlich als Verfechter des Feminismus entdeckten.
Die historische Dimension eines Bindestrichs
Geboren wurde die berühmte Wissenschaftlerin 1867 als Maria Skłodowska in Warschau. Erst nach ihrer Heirat mit Pierre Curie im Jahr 1895 nahm sie den französischen Namen an. Bei ihrem ersten Nobelpreis 1903 wurde sie schlicht als Marie Curie geführt. Doch nach dem Tod ihres Mannes entschied sie sich 1911 bei der Verleihung ihres zweiten Nobelpreises für die Doppelnamenvariante: Marie Skłodowska-Curie. Eine Entscheidung, die sowohl als feministisches als auch als nationales Statement verstanden wurde.
"Ich bin sehr erfreut, dass die EZB auf die polnischen Bedenken eingegangen ist und das Design der neuen 20-Euro-Banknote angepasst hat, um Marie Skłodowska-Curies polnisches Erbe widerzuspiegeln", triumphierte der konservative EU-Abgeordnete Janusz Lewandowski.
Ein Kompromiss mit Fragezeichen
Die EZB hat mittlerweile nachgebessert und führt die Wissenschaftlerin auf ihrer Webseite als "Marie Curie (geboren Skłodowska)". Doch ist damit der Streit beigelegt? Mitnichten. Die Zentralbank betont, dass man noch mit verschiedenen Quellen, einschließlich Curies Nachkommen und dem Institut Curie in Paris, in Gesprächen sei, um die "angemessenste" Bezeichnung zu finden.
Interessanterweise hatte selbst die große Wissenschaftlerin ihre liebe Not mit der Namensfrage. Während ihrer Ehe unterschrieb sie häufig als Skłodowska-Curie, nach Pierres Tod verwendete sie jedoch zunehmend die verkürzte Form "M. Curie", besonders im beruflichen Kontext.
Polen und sein Kampf gegen das Vergessen
Für Polen geht es bei dieser Debatte um weit mehr als nur einen Namen. Ein Land, das in den letzten drei Jahrhunderten dreimal von der Landkarte verschwand, reagiert verständlicherweise empfindlich, wenn es um die Anerkennung seiner historischen Beiträge geht. Die Befürchtung, von den westlichen Nachbarn aus der europäischen Geschichte "herausretuschiert" zu werden, sitzt tief.
Und Polen hat durchaus Erfolg mit seiner Beharrlichkeit: Bereits 2014 gelang es, das Forschungsförderprogramm der EU-Kommission in "Marie Skłodowska-Curie Actions" umzubenennen – ein klarer polnischer Sieg.
Die Ironie des Ganzen
Während sich Diplomaten über Bindestriche streiten, bleibt die eigentliche Ironie unbeachtet: Polen verwendet gar nicht den Euro, sondern hält weiterhin am Złoty fest. Dennoch kämpft das Land vehement um die korrekte Darstellung auf einer Währung, die es selbst nicht nutzt.
Noch pikanter wird die Situation dadurch, dass die europäischen Kulturfiguren möglicherweise gar nicht auf den neuen Scheinen landen werden. Ein alternatives Design mit politisch unverfänglichen Motiven wie Vögeln und Flüssen steht ebenfalls zur Debatte. Die endgültige Entscheidung des EZB-Rats wird für Ende 2026 erwartet, die Ausgabe der neuen Scheine erfolgt erst Jahre später.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass in der EU selbst die kleinsten Details zu großen Debatten führen können. Während sich die Mitgliedsstaaten über Namenskonventionen streiten, warten die wirklich drängenden Probleme Europas weiterhin auf Lösungen. Vielleicht sollte man sich weniger mit der Vergangenheit auf Geldscheinen und mehr mit der Zukunft der europäischen Wirtschaft beschäftigen – aber das wäre wohl zu viel verlangt.
- Themen:
- #EZB

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












