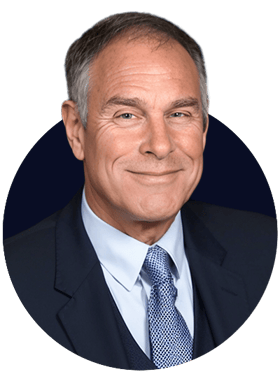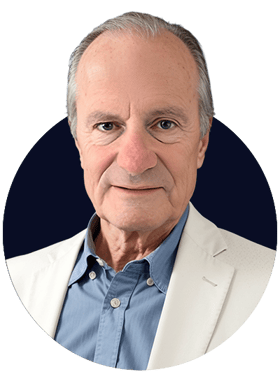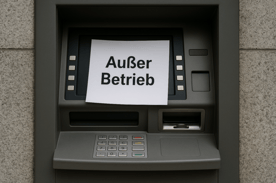Gericht stellt fest: Polizei-Razzia gegen Schülerin war rechtswidrig – Konsequenzen bleiben aus
Ein Urteil, das aufhorchen lässt und gleichzeitig die Frage aufwirft, ob in diesem Land noch mit zweierlei Maß gemessen wird: Das Verwaltungsgericht Greifswald hat den umstrittenen Polizeieinsatz gegen die damals 16-jährige Schülerin Loretta B. für rechtswidrig erklärt. Was im Februar 2024 geschah, liest sich wie ein Lehrstück über behördliche Übergriffigkeit im Namen der vermeintlich guten Sache.
Der Fall, der Deutschland bewegte
Drei Polizeibeamte holten die Jugendliche vor den Augen ihrer Mitschüler aus dem Unterricht – der Vorwurf: angeblich rechtsextreme TikTok-Posts. Eine Aktion, die nicht nur bei der betroffenen Familie, sondern bundesweit für Empörung sorgte. Doch was folgt nun aus diesem richterlichen Urteil? Die ernüchternde Antwort: vermutlich nichts.
Das Gericht stellte unmissverständlich fest, dass die Durchführung der Maßnahme unverhältnismäßig gewesen sei. Ein Gespräch hätte auch zu Hause oder auf der Polizeiwache stattfinden können, so die Richter. Die öffentliche Vorführung vor der gesamten Schulgemeinschaft habe eine unnötige Stigmatisierung hervorgerufen.
Wo bleiben die Konsequenzen für die Verantwortlichen?
Während der normale Bürger für kleinste Vergehen zur Rechenschaft gezogen wird, scheint für Behördenvertreter ein anderes Regelwerk zu gelten. Werden die beteiligten Beamten nun zur Verantwortung gezogen? Muss der Innenminister seinen Hut nehmen? Erhält die Familie eine angemessene Entschädigung – idealerweise aus dem Privatvermögen der Verantwortlichen statt aus Steuergeldern?
Die Realität dürfte ernüchternd ausfallen. Ein behördliches Schreiben mit dem Inhalt "das Handeln war unrechtmäßig" – mehr wird es wohl nicht geben. Die Familie kann sich dieses Dokument gerahmt an die Wand hängen, während die Verantwortlichen unbehelligt ihren Dienst fortsetzen.
Der Schulleiter: Ein besonderer Fall
Besonders pikant ist die Rolle des Schuldirektors, der diese Aktion erst ins Rollen brachte. Ein Mann, der offenbar aus Nordrhein-Westfalen nach Mecklenburg-Vorpommern importiert wurde und nun unter dem Schutz seines Ministers steht. Man könnte meinen, manche Funktionäre hätten sich in anderen politischen Systemen wohler gefühlt – Systeme, in denen das Denunzieren unliebsamer Meinungen zum guten Ton gehörte.
Ein Pyrrhussieg für die Meinungsfreiheit?
Immerhin zeigt das Urteil, dass die Justiz noch funktioniert – zumindest teilweise. Doch was nützt ein Urteil, wenn es folgenlos bleibt? Die junge Loretta und ihre Familie haben einen wichtigen Sieg errungen, doch die strukturellen Probleme bleiben bestehen. In einem Land, das sich gerne als Hort der Demokratie präsentiert, werden Jugendliche wegen unerwünschter Meinungsäußerungen wie Schwerverbrecher behandelt.
Die Ironie dabei: Während man international gerne mit dem Finger auf vermeintlich "illiberale Demokratien" zeigt, cujoniert man hierzulande Kinder wegen ihrer politischen Ansichten. Ein Skandal, der seinesgleichen sucht und der zeigt, wie weit sich dieses Land von seinen eigenen demokratischen Idealen entfernt hat.
Was bleibt?
Das Urteil ist ein kleiner Lichtblick in düsteren Zeiten. Es zeigt, dass es noch Menschen gibt, die sich gegen staatliche Übergriffe zur Wehr setzen. Loretta B. und ihre Familie haben Mut bewiesen – Mut, den in diesem Land immer mehr Bürger aufbringen müssen, um ihre Grundrechte zu verteidigen.
Doch solange die Verantwortlichen keine persönlichen Konsequenzen zu befürchten haben, wird sich nichts ändern. Die Rechnung für behördliche Willkür zahlt am Ende wieder einmal der Steuerzahler – während diejenigen, die diese Aktionen zu verantworten haben, unbehelligt bleiben. Ein Zustand, der in einer funktionierenden Demokratie undenkbar wäre.
- Themen:
- #Wahlen
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
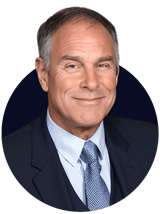
Rick Rule
Rohstoff-Legende
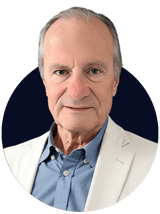
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik