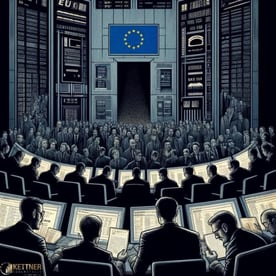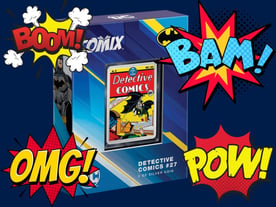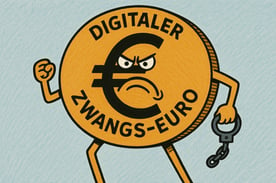Trumps Zollkeule trifft Brasilien mit voller Wucht – EU vorerst verschont
Die Handelspolitik des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump nimmt immer schärfere Konturen an. Während die Europäische Union vorerst aufatmen kann, müssen andere Länder mit drastischen Strafzöllen rechnen. Besonders hart trifft es Brasilien – mit beispiellosen 50 Prozent auf alle Importe. Doch hinter dieser Entscheidung steckt mehr als nur Wirtschaftspolitik.
Politische Rache als Handelsinstrument?
Was Trumps Brief an den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva so brisant macht, ist die unverhohlene Vermischung von Handelspolitik mit innenpolitischen Angelegenheiten eines souveränen Staates. Trump wirft Brasilien vor, zu einer "internationalen Schande" zu werden – nicht etwa wegen Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung, sondern wegen des laufenden Prozesses gegen seinen politischen Verbündeten Jair Bolsonaro.
Der ehemalige brasilianische Präsident, oft als "Trump der Tropen" bezeichnet, steht wegen angeblicher Wahlmanipulation und eines mutmaßlichen Putschversuchs vor Gericht. Trump bezeichnet diese juristischen Verfahren als "Hexenjagd" und fordert deren sofortige Einstellung. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer Trumps Freunde verfolgt, zahlt einen hohen wirtschaftlichen Preis.
Die neue Zolllandkarte der Welt
Die Liste der betroffenen Länder liest sich wie ein Who's Who der Schwellenländer und strategischen Partner. Von Algerien über Indonesien bis zu den Philippinen – überall sollen ab dem 1. August Strafzölle zwischen 20 und 50 Prozent greifen. Besonders pikant: Viele dieser Länder haben gar kein Handelsdefizit mit den USA. Brasilien etwa erzielte 2024 sogar einen Handelsüberschuss von 7,4 Milliarden Dollar zugunsten der Vereinigten Staaten.
Die Begründungen für die Zölle variieren stark. Während bei manchen Ländern das Handelsdefizit als Argument herhalten muss, geht es bei anderen offenbar um geopolitische Machtspiele. Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – könnten sogar mit zusätzlichen zehn Prozent Strafzöllen belegt werden, weil sie es wagen, über Alternativen zum US-Dollar als Leitwährung nachzudenken.
Kupfer als strategische Waffe
Besonders bemerkenswert ist Trumps Ankündigung, pauschal 50 Prozent Zölle auf alle Kupferimporte zu erheben. Seine Begründung klingt martialisch: Kupfer sei das "zweitwichtigste Material des Verteidigungsministeriums". Amerika werde wieder eine "DOMINANTE Kupferindustrie" aufbauen – in Großbuchstaben, versteht sich.
Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben. Kupfer ist essentiell für die Elektroindustrie, den Bausektor und die Energiewende. Höhere Kupferpreise würden nicht nur die amerikanische Industrie belasten, sondern auch Verbraucher treffen. Doch Trump scheint bereit, diesen Preis für seine Vision einer autarken amerikanischen Wirtschaft zu zahlen.
Europa im Auge des Sturms
Dass die EU bislang von neuen Zöllen verschont bleibt, dürfte in Brüssel nur für verhaltene Erleichterung sorgen. Die Drohkulisse steht, und Trump hat bereits angekündigt, weitere Briefe zu veröffentlichen. Die europäische Wirtschaft, ohnehin gebeutelt von hausgemachten Problemen wie der gescheiterten Energiewende und überbordender Bürokratie, kann sich neue Handelshemmnisse kaum leisten.
Die deutsche Exportwirtschaft zeigt bereits Schwächezeichen. Die Ausfuhren in die USA schrumpften zuletzt deutlich – und das noch ohne neue Zölle. Sollte Trump auch Europa ins Visier nehmen, könnte das der deutschen Wirtschaft den Rest geben. Besonders bitter: Während die Große Koalition unter Friedrich Merz vollmundig von Wirtschaftswachstum spricht, fehlen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.
Die neue Weltordnung des Protektionismus
Trumps Zollpolitik markiert einen fundamentalen Bruch mit der jahrzehntelangen Freihandelsdoktrin. Statt auf Kooperation setzt er auf Konfrontation, statt auf Multilateralismus auf bilaterale Deals unter Androhung wirtschaftlicher Vergeltung. Diese "America First"-Politik mag kurzfristig populär sein, langfristig schadet sie jedoch allen Beteiligten.
Besonders perfide ist die Vermischung von Handelspolitik mit innenpolitischen Forderungen, wie im Fall Brasiliens. Wenn Handelsbeziehungen zur Geisel politischer Loyalität werden, untergräbt das die Grundlagen der internationalen Ordnung. Andere Länder könnten diesem Beispiel folgen – mit unabsehbaren Folgen für den Welthandel.
Für Anleger bedeutet diese Entwicklung vor allem eines: erhöhte Unsicherheit. Wenn Zölle willkürlich verhängt und politisch motiviert eingesetzt werden, wird langfristige Planung zur Glückssache. In solchen Zeiten gewinnen krisensichere Anlagen an Bedeutung – allen voran physische Edelmetalle, die unabhängig von politischen Launen ihren Wert behalten.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik