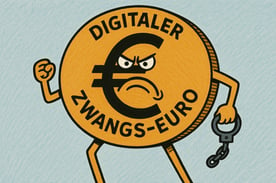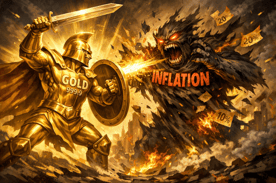Ukraine-Krise: Selenskyjs gescheiterte Außenpolitik führt zur Isolation – Polen und Ungarn wenden sich ab
Die Ukraine steht vor einer dramatischen außenpolitischen Krise. Während Präsident Selenskyj weiterhin stur an seiner kompromisslosen Agenda festhält, bröckelt die Unterstützung seiner wichtigsten Nachbarländer zusehends. Polen und Ungarn, einst zentrale Partner im Kampf gegen Russland, distanzieren sich immer deutlicher von Kiew. Diese Entwicklung könnte sich als verhängnisvoll für die Ukraine erweisen – und zeigt einmal mehr das Versagen der europäischen Politik.
Polens schwindende Unterstützung: Vom Bollwerk zum Bremsklotz
Polen, das seit 2022 stolze 4,5 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt und über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat, scheint seine Rolle als bedingungsloser Unterstützer zu überdenken. Die Wahl des rechtsnationalistischen Karol Nawrocki zum Präsidenten im Juni 2025 markiert einen deutlichen Kurswechsel. Nawrocki lehnt nicht nur den NATO- und EU-Beitritt der Ukraine ab, sondern wirft Kiew sogar vor, seine Verbündeten auszunutzen. Ein schwerer Schlag für Selenskyjs Kriegspolitik.
Die wirtschaftlichen Spannungen verschärfen die Lage zusätzlich. Nachdem die EU zunächst alle Zölle und Kontingente für ukrainische Exporte abgeschafft hatte, führte Polen bereits Anfang 2024 wieder begrenzte Handelsschranken ein – zum Schutz der eigenen Landwirtschaft, wie es hieß. Kiew sah darin zu Recht ein Hindernis für die wirtschaftliche Erholung und die Finanzierung der Kriegsanstrengungen. Die Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen verliefen zäh und zeigten, dass die bedingungslose Solidarität der Vergangenheit angehört.
Historische Altlasten belasten die Beziehungen
Besonders brisant sind die wieder aufflammenden historischen Konflikte. Die Frage der Massaker in Wolhynien und der Umgang mit umstrittenen Figuren wie Stepan Bandera sorgen für diplomatische Verwerfungen. Diese Kontroversen offenbaren die Fragilität eines Bündnisses, das zwar aus strategischen Gründen geschmiedet wurde, aber auf tönernen Füßen steht. Es zeigt sich: Geschichte lässt sich nicht einfach unter den Teppich kehren, besonders nicht, wenn sie für politische Zwecke instrumentalisiert wird.
Ungarn auf Konfrontationskurs: Orbáns "aktive Neutralität"
Noch dramatischer gestaltet sich die Lage mit Ungarn. Viktor Orbán war nie ein glühender Verfechter der Ukraine-Unterstützung, doch mittlerweile haben die Beziehungen einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Im Mai 2025 wiesen sich beide Länder gegenseitig Diplomaten aus – der Vorwurf: Spionage. Der ukrainische Geheimdienst SBU behauptete, Budapest betreibe ein Spionagenetzwerk in der Region Transkarpatien, wo eine große ungarische Minderheit lebt. Die Verdächtigen sollen sogar Szenarien für einen möglichen Einmarsch ungarischer Truppen durchgespielt haben.
Orbáns Außenminister Szijjártó konterte scharf und sprach von "anti-ungarischer Propaganda". Er machte deutlich, dass Maßnahmen gegen Ungarn nicht unbeantwortet bleiben würden. Diese Eskalation zeigt, wie vergiftet das Klima zwischen den beiden Nachbarländern mittlerweile ist.
Energieabhängigkeit und wirtschaftliche Interessen
Ungarns Haltung ist nicht nur ideologisch motiviert. Das Land bleibt stark von russischem Gas und Öl abhängig und hat wiederholt Ausnahmen von den EU-Sanktionen beantragt. Diese pragmatische Energiepolitik steht im krassen Gegensatz zu Kiews Forderung nach vollständiger Abkopplung von Russland. Auch im Agrarsektor gibt es Konflikte: Ungarn befürchtet negative Auswirkungen ukrainischer Getreideexporte auf die eigenen Landwirte und hat entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen.
Orbáns Politik basiert auf zwei Säulen: dem Streben nach guten Beziehungen zu Moskau aus energiepolitischen Gründen und dem Schutz der ungarischen Minderheit in der Westukraine. Diese Position mag aus ungarischer Sicht nachvollziehbar sein, für die Ukraine bedeutet sie jedoch den Verlust eines wichtigen regionalen Partners.
Selenskyjs fatale Fehlkalkulation
Die Entwicklungen in Polen und Ungarn sind symptomatisch für Selenskyjs gescheiterte Außenpolitik. Anstatt auf Kompromisse und regionale Zusammenarbeit zu setzen, verfolgt er eine kompromisslose Maximalpolitik, die seine Nachbarn zunehmend verprellt. Die Slowakei ist der Ukraine bereits feindlich gesinnt, Rumänien befindet sich in innenpolitischen Turbulenzen, und Moldawien ist zu schwach, um ein verlässlicher Partner zu sein.
Diese Isolation ist hausgemacht. Selenskyj hat es versäumt, die legitimen Sicherheitsinteressen und wirtschaftlichen Bedenken seiner Nachbarn ernst zu nehmen. Stattdessen setzt er auf moralischen Druck und die bedingungslose Unterstützung des Westens – eine Strategie, die erkennbar an ihre Grenzen stößt.
Europas Dilemma: Zwischen Kriegsrhetorik und Realität
Die schwindende Unterstützung für die Ukraine in Osteuropa sollte den EU-Eliten zu denken geben. Während in Brüssel weiterhin martialische Rhetorik gepflegt wird, zeigt sich an der Basis eine andere Realität. Die Bürger sind kriegsmüde, die Wirtschaft leidet unter den Sanktionen, und die Energiepreise explodieren. Die neue deutsche Regierung unter Friedrich Merz mag zwar ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur planen, doch dies wird die Inflation weiter anheizen und kommende Generationen belasten – trotz Merz' Versprechen, keine neuen Schulden zu machen.
Es ist an der Zeit, dass Europa seine Ukraine-Politik grundlegend überdenkt. Die bedingungslose Unterstützung eines Landes, das seine Nachbarn verprellt und auf Maximalpositionen beharrt, kann nicht im europäischen Interesse sein. Stattdessen braucht es eine realistische Politik, die auf Verhandlungen und Kompromisse setzt – auch wenn das bedeutet, unbequeme Wahrheiten anzuerkennen.
"In jedem Krieg gibt es Gewinner und Verlierer. Und hier steht Europa bereits auf der Seite der Verlierer."
Diese Warnung sollten sich alle europäischen Politiker zu Herzen nehmen, die weiterhin Öl ins Feuer gießen. Die katastrophale wirtschaftliche Lage der EU, die explodierende Kriminalität durch unkontrollierte Migration und die Spaltung der Gesellschaft durch ideologische Grabenkämpfe – all das sind Symptome einer verfehlten Politik, die Prioritäten falsch setzt. Es ist höchste Zeit für eine Rückkehr zu Vernunft und Realismus. Nur so kann Europa seine Zukunft sichern – und dazu gehört auch die Erkenntnis, dass nicht jeder Konflikt mit militärischen Mitteln zu lösen ist.
- Themen:
- #CDU-CSU

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik