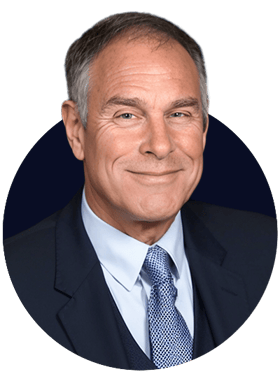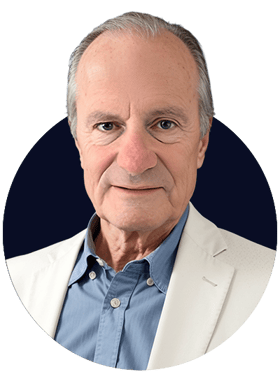Dänemarks Ministerpräsidentin fordert radikale Wende in der EU-Asylpolitik
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen läutet eine Zeitenwende in der europäischen Migrationspolitik ein. Mit dem Beginn der dänischen EU-Ratspräsidentschaft stellt sie die bisherige Asylpraxis fundamental in Frage und findet dabei überraschend breite Unterstützung unter den Mitgliedsstaaten. Der Kampf zwischen demokratisch legitimierter Politik und einem überbordenden "Europarecht"-Komplex hat begonnen – und könnte die EU nachhaltig verändern.
Klare Ansage aus Kopenhagen
Was aus der dänischen Hauptstadt zu vernehmen ist, lässt aufhorchen: Europaministerin Marie Bjerre forderte zu Beginn der Ratspräsidentschaft "ein sichereres, stabileres und robusteres Europa". Dies sei jedoch nur möglich, wenn "wir die Ströme nach Europa kontrollieren". Frederiksen selbst wurde bei ihrem Berlin-Besuch noch deutlicher: Es gelte, "den Zustrom nach Europa zu verringern und diejenigen, die kein Recht haben, in unseren Ländern zu bleiben, wirksam zurückzuschicken".
Diese Worte sind mehr als diplomatische Floskeln. Sie markieren einen fundamentalen Kurswechsel, der sich bereits im Mai abzeichnete, als Frederiksen gemeinsam mit Italiens Giorgia Meloni und sieben weiteren EU-Regierungen einen bemerkenswerten Brief an die Kommission richtete. Die Kernforderung: Die ausufernde Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müsse endlich eingehegt werden.
Der Straßburger Gerichtshof als Problem
Die Kritik der Regierungschefs ist vernichtend: Die Straßburger Richter hätten "den Geltungsbereich der Übereinkunft zu weit ausgedehnt im Vergleich zu ihren ursprünglichen Absichten". Besonders brisant: Diese Rechtsprechung habe "in einigen Fällen unsere Fähigkeit eingeschränkt, politische Entscheidungen in unseren eigenen Demokratien zu treffen".
"Der Schutz der großen Mehrheit der gesetzestreuen Bürger" müsse wieder Vorrang vor den Ansprüchen illegal eingereister oder kriminell gewordener Zuwanderer haben, so die elementare Feststellung des Briefs.
Konkrete Beispiele belegen die Problematik: Im April zwang der Gerichtshof Polen per einstweiliger Anordnung, zwei Frauen aus dem Kongo und Somalia nicht nach Weißrussland zurückzuschieben – trotz der hybriden Bedrohung durch Lukaschenko. Griechenland musste einer Anhängerin des türkischen Oppositionellen Gülen 20.000 Euro Entschädigung zahlen, weil sie in die Türkei zurückgeschoben wurde.
Eine Konvention aus vergangenen Zeiten
Die Europäische Menschenrechtskonvention stammt aus einer Zeit, als Europa zwischen Sozialismus und freier Marktwirtschaft aufgeteilt war. Sie sollte europäische Rechtsgrundsätze sichern und politische Flüchtlinge schützen – innerhalb Europas. Niemand dachte damals daran, deshalb zwei Drittel der Weltbevölkerung aufzunehmen. Genau dahin wollen Frederiksen und ihre Verbündeten zurück: zu einer vernünftigen, auf Europa bezogenen Auslegung.
Breite Allianz für Veränderung
Dänemark steht nicht allein. Mindestens acht weitere Regierungen, darunter Belgien und Österreich, unterstützen den Vorstoß. Sie alle eint die Erkenntnis, dass die Mitgliedsländer nach Jahren der Massenzuwanderung überlastet sind. Selbst die deutsche Bundesregierung unter Friedrich Merz scheint sich dieser Bewegung anzuschließen – die intensivierten Grenzkontrollen sprechen eine deutliche Sprache.
Der italienische Außenminister Tajani nannte die ständigen Vorwürfe des Europarats gegen sein Land "abstrus". Die Lega ging noch weiter und bezeichnete den Europarat als "nutzloses Gebilde, das aufgelöst werden soll". Meloni selbst sprach von "schändlichen" Anschuldigungen und einem "ideologischen Ansatz" des Europarats.
Der wahre Gegner: Die "Europarechtler"
Der eigentliche Widerstand gegen diese demokratische Wende kommt weniger aus einzelnen Hauptstädten als aus einem diffusen Netzwerk von "Europarechtlern", NGOs und supranationalen Institutionen. Diese nicht demokratisch legitimierten Akteure haben sich über Jahre Entscheidungsbefugnisse angeeignet, die ihnen nicht zustehen. Sie bestimmen aus dem Hintergrund die Politik – ein Zustand, den Frederiksen und ihre Verbündeten beenden wollen.
Die dänische Herangehensweise ist dabei typisch skandinavisch: sachlich, aber bestimmt. Frederiksen vermeidet Dramatisierungen, bleibt aber in der Sache hart. Sie betont auch den moralischen Aspekt: Die illegale Migration sei für tausende Todesfälle auf See und an Land verantwortlich.
Ein historischer Wendepunkt?
Was sich hier abzeichnet, könnte tatsächlich eine Zeitenwende sein. Zum ersten Mal formiert sich eine breite Allianz demokratisch gewählter Regierungen gegen die Bevormundung durch supranationale Gerichte und Institutionen. Die Frage ist nicht mehr, ob sich etwas ändern muss, sondern wie radikal diese Änderung ausfallen wird.
Gegenwind ist zu erwarten – aus Spanien, möglicherweise aus Frankreich, und sicher von den üblichen Verdächtigen in Deutschland. Die Sozialdemokraten und indirekt die Grünen könnten versuchen, Merz an die Kandare zu nehmen. Doch die Zeichen stehen auf Sturm: Die Bürger Europas haben genug von einer Politik, die ihre Interessen hintanstellt.
Frederiksens Initiative könnte der Beginn einer echten demokratischen Renaissance in Europa sein – einer Rückkehr zu einer Politik, die sich an den Interessen der eigenen Bürger orientiert statt an abstrakten Rechtsprinzipien, die von realitätsfernen Richtern in Straßburg interpretiert werden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieser Aufbruch gelingt oder ob die alten Kräfte noch einmal die Oberhand behalten.
- Themen:
- #Wahlen
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
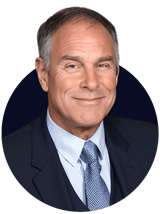
Rick Rule
Rohstoff-Legende
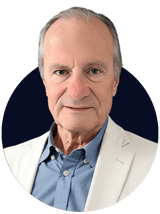
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik