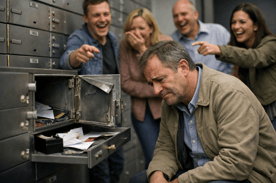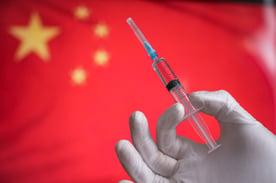Deutsche Traditionsmarken im Rüstungsrausch: Wenn Outdoor-Hersteller zu Waffenbrüdern werden
Die deutsche Rüstungsindustrie erlebt einen beispiellosen Boom – und plötzlich wollen alle mitspielen. Was einst als moralisch fragwürdiges Geschäftsfeld galt, lockt nun selbst Outdoor-Marken und Fluggesellschaften an. Der Grund? Milliardenschwere Staatsaufträge, die kriselnde Unternehmen wie Rettungsringe ergreifen.
Vom Wanderschuh zum Kampfstiefel: Die neue deutsche Realität
Besonders pikant ist der Fall des bayerischen Outdoor-Herstellers Schöffel aus Schwabmünchen. Das Familienunternehmen, das seit drei Jahren keinen Gewinn mehr erwirtschaftet habe, sieht im Militärgeschäft offenbar die letzte Rettung. 77.000 Bundeswehr-Hosen sollen es richten – und das ist erst der Anfang. Der 26-jährige Firmenchef Jakob Schöffel träume davon, dass die Militärsparte in fünf Jahren genauso viel Umsatz generiere wie das traditionelle Sportbekleidungsgeschäft.
Die rhetorische Verrenkung, mit der sich das Unternehmen rechtfertigt, ist bemerkenswert: Man sei „nicht Teil der Rüstungsindustrie", sondern liefere lediglich „Verteidigungs- und Sicherheitsausstattung". Als ob Soldaten ihre Schöffel-Hosen zum Wandern in Afghanistan tragen würden. Diese semantische Akrobatik zeigt, wie unbequem vielen Unternehmen ihr neuer Geschäftszweig offenbar ist.
Die große Transformation: Wenn Volkswagen Panzer baut
Doch Schöffel ist bei weitem nicht allein. Die Liste der deutschen Traditionsunternehmen, die plötzlich ihr Herz für die Landesverteidigung entdecken, liest sich wie das Who's who der deutschen Wirtschaft. Volkswagen produziert gemeinsam mit Rheinmetall militärische Lastkraftwagen, die Lufthansa wartet Kampfjets, und Siemens digitalisiert die Rüstungsindustrie. Man könnte meinen, die gesamte deutsche Wirtschaft habe über Nacht ihre pazifistische Ader verloren.
„Rechnet man alles zusammen, dann wird es bei diesen Aufträgen um mehrere Milliarden Euro gehen"
Diese Milliarden stammen natürlich aus dem Steuersäckel – aus jenem berüchtigten „Sondervermögen", das die Ampel-Regierung aufgelegt hatte und das die neue Große Koalition unter Friedrich Merz nun weiterführt. 24 Milliarden Euro allein für 2025, während gleichzeitig bei Bildung und Infrastruktur gespart wird. Aber wer braucht schon funktionierende Schulen, wenn die Bundeswehr die modernsten Kampfhosen trägt?
Die bittere Ironie der deutschen Wirtschaftspolitik
Die Ironie dieser Entwicklung könnte kaum größer sein. Jahrzehntelang predigten deutsche Politiker die Überlegenheit der sozialen Marktwirtschaft, während sie gleichzeitig eine Wirtschaftspolitik betrieben, die mittelständische Unternehmen in die Knie zwang. Billigkonkurrenz aus Asien, explodierende Energiekosten durch die verfehlte Energiewende, überbordende Bürokratie – all das trieb traditionsreiche Firmen an den Rand des Ruins.
Nun bietet ausgerechnet der Staat mit seinen Rüstungsaufträgen den rettenden Strohhalm. Unternehmen, die einst stolz darauf waren, Familien mit hochwertiger Outdoor-Bekleidung auszustatten, nähen nun Uniformen für Soldaten. Die Transformation vom zivilen zum militärischen Zulieferer wird zur Überlebensstrategie in einem Land, dessen Politik die eigene Wirtschaft systematisch gegen die Wand gefahren hat.
Der Preis der neuen Militarisierung
Besonders perfide: Die Unternehmen müssen Fixpreise für sieben Jahre akzeptieren, ohne zu wissen, wie sich Energie-, Rohstoff- und Lohnkosten entwickeln werden. In Zeiten galoppierender Inflation und explodierender Energiepreise – auch dank der gescheiterten Energiepolitik der vergangenen Jahre – ein enormes Risiko. Doch was bleibt den Firmen anderes übrig? Der zivile Markt schwächelt, die Konsumenten sparen, und die Politik versagt auf ganzer Linie.
Die neue Große Koalition unter Merz setzt diese Politik nahtlos fort. Statt die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft anzugehen, pumpt man weitere Milliarden in die Rüstung. Das mag kurzfristig einigen Unternehmen helfen, löst aber nicht die grundlegenden Probleme: zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie, zu teure Energie und eine ideologiegetriebene Wirtschaftspolitik, die traditionelle Industrien systematisch benachteiligt.
Ein Blick in die Zukunft: Deutschland als Waffenschmiede Europas?
Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft? Werden wir in zehn Jahren ein Deutschland erleben, in dem jedes zweite Unternehmen direkt oder indirekt für die Rüstungsindustrie arbeitet? Wo der Staat als größter Auftraggeber die Wirtschaft am Leben erhält, während der freie Markt kollabiert?
Die Gefahr einer solchen Entwicklung ist real. Wenn Unternehmen erst einmal den süßen Geschmack garantierter Staatsaufträge gekostet haben, fällt die Rückkehr zum harten Wettbewerb schwer. Die Abhängigkeit vom Staat wächst, die unternehmerische Innovation verkümmert. Am Ende steht eine Wirtschaft, die ohne Rüstungsaufträge nicht mehr überlebensfähig ist.
Dabei gäbe es Alternativen: Eine vernünftige Energiepolitik, die Unternehmen nicht in den Ruin treibt. Ein Abbau der ausufernden Bürokratie. Eine Steuerpolitik, die Leistung belohnt statt bestraft. Doch stattdessen setzt die Politik auf kurzfristige Lösungen und militärische Aufrüstung. Die wahren Probleme bleiben ungelöst, während deutsche Traditionsmarken zu Waffenbrüdern mutieren.
In dieser Situation bleibt für den klugen Anleger nur eine Konsequenz: Wer sein Vermögen vor den Unwägbarkeiten einer zunehmend militarisierten und staatsabhängigen Wirtschaft schützen will, sollte auf bewährte Sachwerte setzen. Physische Edelmetalle wie Gold und Silber bieten seit Jahrtausenden Schutz vor politischen Fehlentscheidungen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Sie sind unabhängig von Staatsaufträgen, Rüstungsbudgets und politischen Moden – und damit die einzig verlässliche Konstante in unsicheren Zeiten.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik