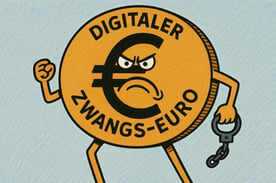Deutsches Rechtssystem kapituliert vor Tech-Giganten: Kammergericht weist Klage gegen X ab
Ein bitteres Urteil für alle, die noch an die Durchsetzungskraft deutscher Gerichte glaubten: Das Kammergericht Berlin hat zwei Frauen, die sich gegen antisemitische Hetze auf der Plattform X wehren wollten, eine schallende Ohrfeige verpasst. Mit seinem Urteil vom 10. Juli 2025 (Az.: 10 U 104/24) demonstrierte das Gericht eindrucksvoll, wie hilflos unser Rechtssystem gegenüber internationalen Tech-Konzernen agiert.
Wenn Formalien wichtiger sind als der Kampf gegen Antisemitismus
Die beiden Klägerinnen hatten nichts Geringeres verlangt, als dass X eindeutig antisemitische und volksverhetzende Beiträge von seiner Plattform entfernt. Beiträge, die nicht nur gegen geltendes Recht, sondern auch gegen die hauseigenen Richtlinien der Plattform verstießen. Doch statt sich mit dem eigentlichen Skandal zu befassen – der ungehinderten Verbreitung von Judenhass im digitalen Raum – verstrickte sich das Gericht in formaljuristischen Spitzfindigkeiten.
Die Begründung des Kammergerichts liest sich wie eine Kapitulationserklärung: Deutsche Gerichte seien nicht zuständig, da X seinen Sitz in Irland habe. Die Frauen müssten gefälligst nach Dublin pilgern, wenn sie ihr Recht durchsetzen wollten. Eine groteske Vorstellung in Zeiten, in denen digitale Plattformen grenzenlos agieren, aber sich hinter nationalen Zuständigkeiten verstecken können.
Verbraucherschutz als Farce
Besonders perfide wird es bei der Frage des Verbraucherschutzes. Die EU-Verordnung hätte den Klägerinnen theoretisch ermöglicht, vor deutschen Gerichten zu klagen – wenn sie denn als Verbraucherinnen anerkannt worden wären. Doch hier zeigte das Gericht seine ganze Kleinlichkeit: Die eine Klägerin habe zu wenig Informationen geliefert, die andere ihre Wohnadresse nicht angegeben. Als ob es bei der Bekämpfung von Antisemitismus auf solche Nebensächlichkeiten ankäme!
"Das Verfahren offenbart, wie schwer es für Nutzer ist, ihre Rechte gegenüber großen Plattformen durchzusetzen", konstatierte Josephine Ballon von der Organisation HateAid treffend.
Diese Aussage trifft den Nagel auf den Kopf. Während Tech-Giganten wie X Milliarden scheffeln und gleichzeitig als Brutstätte für Hass und Hetze fungieren, werden normale Bürger mit bürokratischen Hürden abgespeist. Die Botschaft ist klar: Wer sich gegen digitale Gewalt wehren will, muss erst einmal einen juristischen Hindernislauf absolvieren.
Ein Armutszeugnis für den deutschen Rechtsstaat
Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, versuchte die Wogen zu glätten und erklärte, das Urteil sei "selbstverständlich zu akzeptieren". Doch seine anschließende Kritik an X zeigt die ganze Hilflosigkeit der Politik: Man kann zwar kritisieren, aber effektiv handeln? Fehlanzeige!
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hatte vollmundig versprochen, "Verantwortung für Deutschland" zu übernehmen. Doch wo bleibt diese Verantwortung, wenn deutsche Gerichte sich für nicht zuständig erklären, sobald ein Unternehmen seinen Briefkasten im Ausland hat? Wo bleibt der Schutz der Bürger vor digitaler Gewalt und Hetze?
Die wahren Profiteure: Tech-Konzerne und Extremisten
Während sich deutsche Gerichte hinter Formalien verstecken, reiben sich die wahren Profiteure die Hände: Einerseits die Tech-Konzerne, die ungestört ihre Geschäfte betreiben können, ohne sich um nationale Gesetze scheren zu müssen. Andererseits die Extremisten und Hetzer, die wissen, dass sie auf Plattformen wie X nahezu ungestraft agieren können.
Es ist ein Trauerspiel, dass ausgerechnet in Deutschland, das aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus trägt, die Justiz so kläglich versagt. Statt klare Kante zu zeigen, versteckt man sich hinter EU-Verordnungen und Zuständigkeitsfragen.
Zeit für echte Lösungen statt juristischer Winkelzüge
Was wir brauchen, sind keine weiteren 500-Milliarden-Sondervermögen für fragwürdige Klimaprojekte, wie sie die Merz-Regierung plant. Was wir brauchen, ist ein funktionierender Rechtsstaat, der seine Bürger vor digitaler Gewalt schützt – unabhängig davon, wo die Täter ihren Firmensitz haben.
Die Tatsache, dass HateAid ankündigt, weiter gegen X vorzugehen, zeigt zumindest, dass es noch Menschen gibt, die nicht kampflos aufgeben. Doch es sollte nicht die Aufgabe von gemeinnützigen Organisationen sein, das zu tun, was eigentlich Aufgabe des Staates wäre: seine Bürger zu schützen.
Solange deutsche Gerichte lieber Paragrafen reiten, statt Recht zu sprechen, werden wir weiter zusehen müssen, wie der digitale Raum zur rechtsfreien Zone verkommt. Ein Armutszeugnis für ein Land, das sich gerne als Vorreiter in Sachen Rechtsstaat und Demokratie präsentiert.
- Themen:
- #CDU-CSU

FINANZIELLE SELBSTVERTEIDIGUNG
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:
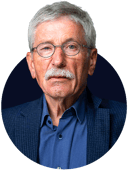
Thilo Sarrazin
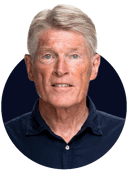
Ernst Wolff

Florian Homm

Thorsten Schulte

Prof. Dr. R. Werner

Paul Brandenburg
AMLA & Kontrolle
ab 1. Juli 2025
Konkrete Lösungen
zum Schutz
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik