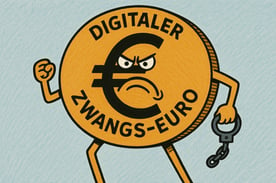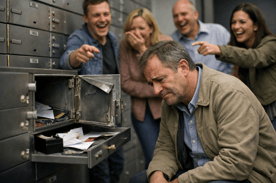Verfassungsschutz darf AfD weiter beobachten – Gericht schmettert Beschwerde ab
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat der Alternative für Deutschland eine herbe Niederlage beschert. Die Richter wiesen die Beschwerde der Partei gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall zurück. Damit bleibt die AfD weiterhin im Visier des Inlandsgeheimdienstes – mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt.
Die Entscheidung bestätigt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster aus dem vergangenen Jahr. Der Verfassungsschutz dürfe die Partei weiterhin mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen, so die Richter. Das bedeutet konkret: V-Leute können eingeschleust, Kommunikation überwacht und Informationen gesammelt werden. Ein Instrument, das normalerweise gegen Terroristen und Staatsfeinde eingesetzt wird.
Der nächste Schritt: Karlsruhe
Für die AfD ist der Weg durch die Verwaltungsgerichte damit vorerst beendet. Die Partei kündigte bereits an, sich nun an das Bundesverfassungsgericht wenden zu wollen. Ob die Karlsruher Richter dem Anliegen stattgeben werden, bleibt abzuwarten. Die Hürden für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde sind bekanntlich hoch.
Parallel zu diesem Verfahren läuft ein weiterer Rechtsstreit am Verwaltungsgericht Köln. Dort wehrt sich die AfD gegen eine noch schärfere Einstufung. Anfang Mai hatte der Verfassungsschutz die Partei in einer Pressemitteilung als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" bezeichnet – eine Hochstufung, die noch weitreichendere Überwachungsmaßnahmen ermöglichen würde.
Rückzieher des Verfassungsschutzes
Interessanterweise ruderte die Behörde bereits zurück. In einem Schreiben an die AfD-Anwälte teilte man mit, die Partei bis zur gerichtlichen Entscheidung nicht mehr öffentlich als "gesichert rechtsextremistisch" zu bezeichnen. Die entsprechende Pressemitteilung verschwand von der Internetseite. Ein taktischer Rückzug, um einer möglichen gerichtlichen Niederlage zuvorzukommen?
Es ist nicht das erste Mal, dass der Verfassungsschutz in dieser Angelegenheit zurückrudern muss. Bereits 2021 hatte die Behörde voreilig die AfD öffentlich als Verdachtsfall eingestuft, musste dann aber aufgrund eines Eilbeschlusses des Verwaltungsgerichts Köln diese Äußerungen unterlassen. Die Frage drängt sich auf: Agiert der Inlandsgeheimdienst hier wirklich neutral und rechtsstaatlich oder lässt er sich von politischen Interessen leiten?
Ein Präzedenzfall mit Folgen
Die Beobachtung einer im Bundestag vertretenen Partei durch den Verfassungsschutz ist kein Pappenstiel. Es handelt sich um einen massiven Eingriff in die politische Willensbildung. Kritiker sehen darin ein gefährliches Instrument, mit dem unliebsame politische Konkurrenz mundtot gemacht werden könnte. Befürworter argumentieren hingegen, die Demokratie müsse sich gegen ihre Feinde wehren können.
Die Geschichte der Bundesrepublik kennt durchaus Fälle, in denen der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert wurde. Man denke nur an die Beobachtung von Politikern wie Oskar Lafontaine oder die jahrzehntelange Überwachung der Linkspartei und ihrer Vorgängerorganisationen. Die Grenze zwischen legitimer Sicherheitsvorsorge und politischer Einflussnahme ist oft fließend.
Was bedeutet das für die politische Landschaft?
Die fortgesetzte Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz hat weitreichende Konsequenzen. Beamte und Angehörige der Sicherheitsbehörden müssen ihre Mitgliedschaft in der Partei offenlegen oder riskieren disziplinarische Maßnahmen. Für viele Wähler könnte die Einstufung abschreckend wirken – oder im Gegenteil: Sie könnte die Partei in ihrer Opferrolle bestärken und ihr zusätzliche Sympathien einbringen.
In Zeiten, in denen über 25 Prozent der Sitze im EU-Parlament von rechtskonservativen und konservativen Parteien besetzt werden, stellt sich die Frage, ob die deutsche Praxis der Verfassungsschutzbeobachtung noch zeitgemäß ist. Während in anderen europäischen Ländern ähnliche Parteien längst in Regierungsverantwortung stehen, wird hierzulande mit geheimdienstlichen Mitteln gegen sie vorgegangen.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mag juristisch korrekt sein. Politisch wirft sie jedoch Fragen auf, die weit über den konkreten Fall hinausgehen. In einer Demokratie sollte der politische Wettbewerb auf dem Marktplatz der Ideen stattfinden – nicht in den Hinterzimmern der Geheimdienste.
- Themen:
- #AFD

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik